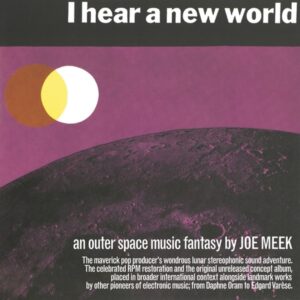(Scroll down for english version)
Sagt einem Thomas Mann heute noch etwas? Soll man diese alten Kamellen wirklich noch lesen?
Die Weimarer Zeit und besonders ihre Kabarettszene interessiert mich seit je, damals wie heute. Neben Altmeister Tucholsky war Klaus Mann einer der wichtigen Impulsgeber. Seinen Roman "Mephisto", 1936 im Exil geschrieben, musste ich schon der Verfilmung von 1981 wegen lesen (Regie: István Szabó; Oscar für "Best Foreign-Language Film"; Brandauer spielte darin wie immer Brandauer). In den Cafés rund um die Uni war der Film ein Dauerthema, den wir immer wieder diskutiert haben -- da der Roman ja als "Schlüsselroman" galt, erzeugte er jede Menge "Wer-ist-wer?"-Spekulationen, und man stieß auf Namen, die kaum noch jemand unterzubringen wusste. Ich, als an Kabarettgeschichte Interessierter, kannte etliche der Namen. Über die historischen Unebenheiten des Romans sahen wir damals großzügig hinweg; ein lesenswertes Buch über einen Karrieristen, der sich selbst in die Falle geht, ist "Mephisto" allemal.

Und da ich dann schon bei Klaus Mann war, mussten "Treffpunkt im Unendlichen" und "Der Wendepunkt" folgen; letzteres Buch ist unverzichtbare Lektüre, wenn man sich für die politische und gesellschaftliche Situation der Ära interessiert -- es ist erschreckend aktuell, aber weniger klatschsüchtig als Florian Illies (dem es in seinen Büchern wohl mehr auf den Unterhaltungsfaktor ankommt).
Mit Klaus war ich dann schon mal im Kraftfeld der Mann-Familie. Man kommt schwer heraus, wenn man mal drin ist. Denn auch "Der Untertan" von Heinrich Mann erwies sich als fesselnde Entdeckung -- und das, obwohl wir den auch schon Jahre vorher im Deutschunterricht besprochen hatten. Aber da kam es wie meist in solchen Fällen: Literaturexegesen im Schulunterricht sind eine ziemlich sichere Methode, einem auch die besten Werke zu vermiesen. Die Wiederentdeckung jedoch belehrte mich eines Besseren: "Der Untertan" ist eine großartige Geschichte. (Es gibt auch eine meisterliche Verfilmung von 1951 in der Regie von Wolfgang Staudte.)
Und so bin ich dann letzten Endes auch auf den Herrn Papa selbst gestoßen -- keine Ahnung, in der wievielten Auflage dieses Werk von 1901 inzwischen erschienen ist, aber dies hier ist die Taschenbuchausgabe, die ich noch immer im Regal habe:
Auch diesen Roman muss ich als Student zu lesen begonnen haben. Da bin ich mir ziemlich sicher, denn ich kann mich daran erinnern, dass es mir auf die Nerven ging, wie Thomas Mann jeden Kerzenhalter und jeden Kniff in jedem Sofakissen bis hinein in winzigste Details beschreibt. Ob ich die 759 Seiten damals bis zu Ende durchgelesen habe? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr.
Nun wollte aber der Zufall, dass ich vor einiger Zeit anlässlich Thomas Manns 150. Geburtstag in der ARD-Mediathek auf den Dreiteiler Die Manns -- Ein Jahrhundertroman (2001, Trailer) von Heinrich Breloer und Horst Königstein stieß. Wie diese beiden das auch in anderen Produktionen schon gemacht hatten, kombinieren sie in dieser (wie man heute sagen würde) "Miniserie" nachgespielte, manchmal auch fiktionale, Szenen mit Originaldokumenten aus dem Leben der erweiterten Mann-Familie. Da kommen sie alle vor, Thomas, Klaus, Heinrich, Erika, Golo, Katia, Monika, Elisabeth, Frido, die Pringsheims, Gustaf Gründgens (alias Mephisto), kurz: der ganze Clan, das Ganze in exzellenter Besetzung, und ein spannendes Stück Zeitgeschichte sowieso.
Dies wiederum brachte mich zu "Deutsche Hörer!", der von Mely Kiyak herausgegebenen vollständigen Sammlung der Radioansprachen, die Thomas Mann ab 1941 von Los Angeles aus via BBC nach Deutschland schickte.
Unbedingt lesenswert. Man staunt, mit welcher Wucht, mit welcher Präzision und gleichzeitig mit welcher Hellsichtigkeit Thomas Mann die Naziherrschaft zersägt. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. (Heißer Tipp nur: das Ganze nicht in einem Rutsch durchlesen, sondern eine Ansprache pro Tag.)
Thomas Mann also doch. Aber noch hatte ich die unendlich vielen, nervenden Kniffe in den Sofakissen nicht vergessen. Waren die nicht immer noch im Weg?
Es kommt darauf an, wie man die Geschichte liest. Diesmal habe ich "Buddenbrooks" wirklich von der ersten bis zur letzten Seite gelesen, und nach anfänglicher Widerborstigkeit der Story bin ich zunehmend in ihr versunken. Der Untertitel "Verfall einer Familie" zeigt, was zu erwarten steht: Es geht um eine zunächst wohlhabende Lübecker Kaufmannsfamilie und ihren sich über vier Generationen hinziehenden Untergang, beginnend 1835, bis die Geschichte 1877 in Pleite, Krankheit und Tod endet. Thomas Mann schrieb vier Jahre an dem Buch. Er kannte das Milieu, über das er spricht. Natürlich ist es keine Dokumentation, aber etliche der Personen haben reale Vorbilder; in Teilaspekten der Figur Hanno taucht Thomas Mann sogar selbst auf.
Die mir vorliegende Fassung folgt in Rechtschreibung und Grammatik den Regeln des Jahres 1901, und auch, wenn dies anfangs ein wenig irritiert, erweist es sich letztlich doch als richtig.
Auch ohne den Untertitel ahnt man recht bald, dass hier keine Erfolgsgeschichte erzählt wird. An der Oberfläche erfährt man eine Menge über die Lebensverhältnisse der Menschen jener Jahre, man lernt ihre Gewohnheiten, ihre Schicksale, ihr Handeln, ihre (meist kleinen) Erfolge kennen, ebenso auch ihr Versagen im Rahmen der Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung standen. Thomas Mann beschreibt sie ebenso liebevoll wie meisterlich; nach einer Weile meint man sogar ihre Stimmen zu hören.
Liest man die Marotten, mit denen Thomas Mann seine Akteure ausstattet, hat man manchmal schon fast den Eindruck, ein modernes Drehbuch zu lesen: Er beherrschte schon damals die Tricks, seine Personen leitmotivisch wiedererkennbar zu machen, sei es durch Dialekte ("Ick heww da nu 'naug von!"), bestimmte Redewendungen (" ... sei glöcklich, du gutes Kend", zu welchet stets auch ein "knallender Kuss auf die Stirn" appliziert wird. So wird jede Figur mit individuellen Gewohnheiten oder Eigenarten ihres Auftretens ausgestattet, etwa Antonie (Tony), die bei allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten immer wieder ihr Beharren darauf zur Schau stellt, "kein dummes Ding mehr" zu sein und zu wissen, was sie "vom Leben zu halten" habe. Die geradezu satirische Schilderung einer Lübecker Ratsversammlung könnte aus dem heutigen Bundestag stammen. Und doch fehlt jede Häme; Mann macht sich über keinen seiner Charaktere lustig, immer lässt er ihnen einen letzten Rest Würde.
Thomas Mann bedient die volle Bandbreite zwischen hochkomischen und todtraurigen Ereignissen, Erfolgen und Fehlschlägen; sein Gespür für das richtige Timing ist bewundernswert. Die meisten der geschilderten Ereignisse kann man herannahen sehen, ihre unvermeidlichen Konsequenzen folgen dann glashart, und der Autor geht mit seinen Charakteren alles andere als schonend um. Allerdings auch nicht mit dem Leser -- insbesondere seine Schilderungen von Krankheits- oder Todesfällen gehen nicht selten bis an den Rand des Erträglichen.
Das
heißt nicht, dass es keine Schwerpunkte gibt. Thomas Mann hat auch
Lieblinge, denen er größere Aufmerksamkeit widmet als anderen -- Tony
sei als Beispiel genannt, ebenso das verhinderte musikalische Wunderkind
Hanno Buddenbrook, an dessen Beispiel Mann in einer Art Exkurs das
elende Schulsystem der damaligen Zeit schildert. (Tatsächlich spricht Thomas Mann in diesen Abschnitten offenkundig über seine eigene Schulzeit, die purer Horror gewesen sein muss. Diese fallen ein wenig aus dem Rahmen der Handlung, und doch kann man diese
Episoden nicht weglassen, ohne dass der Geschichte ein wichtiger Farbton
fehlen würde.)
Aber dies alles ist eigentlich noch nicht das Entscheidende; es ist nicht das, was diesen Roman und seinen Autor so herausragend macht. Thomas Mann geht es in seinem Schreiben nicht primär darum, wie man heute sagen würde, "Content" zu liefern. Das tut er mit seinem breiten Bildungsspektrum sowieso, ganz nebenbei.
Das Geheimnis liegt in Thomas Manns Schreibstil und der Art, wie er einem Architekten gleich einen Bauplan verfolgt. Ich habe während des Lesens zunehmend an den Aufbau einer Mahler- oder Bruckner-Sinfonie denken müssen. Da könnte man leicht versucht sein, zu sagen: Das hättste auch einfacher haben können, zum Beispiel als Klaviersonate oder als Streichquartett. Aber es geht eben nicht nur darum, ein paar Melodien passend zusammenzustellen, sondern eine Sinfonie arbeitet Leitmotive, Melodien, Stimmen, Variationen, Klangfarben, Tempi und Dynamikabstufungen aus bis in die letzte Verzweigung. Erst aus diesem Zusammenspiel ergibt sich das Gesamtbild. Nichts darf fehlen, auch wenn man den Sinn vielleicht nicht sofort erkennt.
Eine Sinfonie in dieser Weise zu hören erfordert geistige Mitarbeit, aber die zahlt sich aus. Auf das Tempo und den langen Atem der "Buddenbrooks" muss man sich einlassen wollen. Die Zeit muss man sich nehmen. Diese Geschichte ist ein sinfonisches Gesamtkunstwerk; jeder Satz hat hier seine Bedeutung und seinen Sinn, aber er erschließt sich erst in der Gesamtschau. "Buddenbrooks" ist ein klingender Kosmos.
Man ist das heute vielleicht nicht mehr gewohnt. Ein Grund mehr, in diese Geschichte einzutauchen. Man kommt als veränderter Leser wieder heraus.
*
Does Thomas Mann still mean anything to anyone today? Should we really still be reading these old chestnuts?
The Weimar era, and especially its cabaret scene, has always fascinated me. Alongside the old master Tucholsky, Klaus Mann was one of my triggers. I had to read his novel "Mephisto," written in exile in 1936, because of the 1981 film adaptation (directed by István Szabó; Oscar for Best Foreign Language Film; Brandauer played Brandauer, as always). "Mephisto" is about Gustaf Gründgens, a personal friend of Klaus Mann and a very famous actor in Germany; he became a legend for his role as Mephisto in Goethe's "Faust", which finally made him a favorite of the Nazis. During my university time, film and book were constant topics of discussion at the cafeteria—since the novel was considered a "roman à clef," it generated a lot of "who's who?" speculation, and we stumbled across names that hardly anyone recognized anymore. As the history of cabaret was always a point of interest for me, I knew many of them. Back then, we generously overlooked the historical inaccuracies of the story, but "Mephisto" is certainly a worthwhile book about a careerist who traps himself.

And since I was already on the subject of Klaus Mann, "Treffpunkt im Unendlichen" ("Meeting Place at Infinity") and "Der Wendepunkt" ("The Turning Point") had to follow; the latter is essential reading for anyone interested in the political and social situation of the era—it's frighteningly relevant, but less gossipy than Florian Illies's recent works (who seems to prioritize the entertaining aspects of the Weimar era in his books).
With Klaus, I was already immersed in the Mann family's sphere of influence. It's hard to get out once you're in. Heinrich Mann's "Der Unteran" ("The Loyal Subject") also proved to be a captivating discovery—even though we had discussed it years before in German class. But as is often the case, literary analysis in school is a pretty surefire way to ruin even the best works. The rediscovery, however, proved me wrong: "The Loyal Subject" is a magnificent story. (There's also a masterful film adaptation from 1951 directed by Wolfgang Staudte.)
And that's how I finally came across the man himself—I have no idea what edition this 1901 work is in by now, but this is the paperback edition I still have on my shelf:

I must have started reading this novel as a student. I'm quite certain of that, because I remember how irritating Thomas Mann's meticulous descriptions of every candlestick and every detail of every sofa cushion were. Did I actually finish all 759 pages back then? To be honest, I don't remember.
But as luck would have it, some time ago, on the occasion of Thomas Mann's 150th birthday, I stumbled upon the three-part TV series Die Manns -- Ein Jahrhundertroman (The Manns – A Century Novel) (2001, trailer) by Heinrich Breloer and Horst Königstein in the ARD media library. As these two had already done in other productions, they combine reenacted, sometimes fictional, scenes with original documents from the lives of the extended Mann family in this (what we would now call) "miniseries." They're all there: Thomas, Klaus, Heinrich, Erika, Golo, Katia, Monika, Elisabeth, Frido, the Pringsheims, Gustaf Gründgens (alias Mephisto)—in short, the whole clan, given by an excellent cast, and a fascinating piece of contemporary history to boot.
This, in turn, led me to "Deutsche Hörer!" ("German Listeners!"), the complete collection of radio addresses that Thomas Mann sent to Germany from Los Angeles via the BBC, edited by Mely Kiyak.

It's absolutely worth reading. You'll be amazed by the force, precision, and sheer perspicacity with which Thomas Mann dismantles the way the Nazi regime works. He leaves no stone unturned. (Don't read the whole book in one go, better read one speech per day.)
So, Thomas Mann after all. But I hadn't yet forgotten the countless, irritating trinkets in the sofa cushions. Could they still be in the way?
It all depends on how you read the story. This time I really did read "Buddenbrooks" from cover to cover, and after the story's initial resistance, I became increasingly engrossed. The subtitle, "The Decline of a Family," reveals what to expect: It's about a once-wealthy Lübeck merchant family and their decline, which unfolds over four generations, beginning in 1835 and culminating in bankruptcy, illness, and death in 1877. Thomas Mann spent four years writing the book. He knew the milieu he was writing about. Of course, it's not a documentary, but several of the characters are based on real people; Thomas Mann himself even appears in certain aspects of the character Hanno.
The version I have follows the spelling and grammar rules of 1901, and although this is a little disconcerting at first, it ultimately proves to be correct.
Even without the subtitle, one soon suspects that this will not be a success story. On the surface, one learns a great deal about the living conditions of people in those years; one becomes acquainted with their habits, their fates, their actions, their (mostly small) successes, as well as their failures within the constraints of the opportunities available to them. Thomas Mann describes them with both affection and mastery; after a while, one almost feels as if one can hear their voices.
Reading about the quirks Thomas Mann endows his characters with, one sometimes almost gets the impression of reading a modern screenplay: Even back then, he mastered the tricks of making his characters instantly recognizable through leitmotifs, be it dialects (like the low-german "Ick heww da nu 'naug von!" -- "Enough already!"), or certain turns of slightly mispronunciated phrase ("...sei glöcklich, du gutes Kend" -- "... be happy, you good child"), to which a "pounding kiss on the forehead" is always added. Thus, each character is endowed with individual habits or peculiarities of behavior, such as Antonie (Tony), who, at every conceivable and inconceivable opportunity, repeatedly displays her insistence that she is "no longer a silly thing" and knows what she "should think of life." The almost satirical depiction of a Lübeck city council meeting could have come from today's Bundestag. And yet, there is no malice whatsoever; Mann never mocks any of his characters, always allowing them a vestige of dignity.
Thomas Mann covers the full spectrum between highly comical and heartbreaking events, successes and failures; his sense of timing is admirable. Several of the events depicted can be foreseen, their inevitable consequences then follow with chilling force, and the author is anything but gentle with his characters. Nor, however, with the reader—his descriptions of illness or death, in particular, often push the boundaries of what is bearable.
This doesn't mean there aren't focal points. Thomas Mann also has favorites to whom he devotes more attention than others—Tony, for example, as well as the thwarted musical prodigy Hanno Buddenbrook, through whose example Mann, in a kind of digression, describes the wretched school system of the time. (In fact, in these sections, Thomas Mann is clearly talking about his own school days, which sometimes must have been pure horror. These falls somewhat outside the main plot, and yet these episodes cannot be omitted without the story losing an important nuance.)
But all this is actually not the crucial point; it is not this what makes this novel and its author so outstanding. Thomas Mann's writing isn't primarily about delivering "content," as we might say today. He does that anyway, quite incidentally, with his broad erudition.
The secret lies in Thomas Mann's writing style and the way he follows a blueprint, like an architect. While reading, I increasingly found myself thinking about the structure of a Mahler or Bruckner symphony. One might be tempted to say: You could have done it more simply, as a piano sonata, for example, or a string quartet. But it's not just about putting a few melodies together; a symphony develops leitmotifs, melodies, voices, variations, timbres, tempi, and dynamic gradations down to the last detail. Only from this interplay does the complete picture emerge. Nothing can be missing, even if you don't immediately grasp the meaning.
Listening to a symphony in this way requires intellectual engagement, but it's well worth it. The pace and sweeping narrative of "Buddenbrooks" you have to be willing to engage with it. You have to take the time. This story is a symphonic Gesamtkunstwerk; every movement has its meaning and purpose, but it only reveals itself in the overall context. "Buddenbrooks" is a cosmos of sound.
Maybe we're not used to this kind of reading anymore. All the more reason to immerse yourself in this story. You'll emerge a changed reader.